Schadstoffe im Innenraum – die Stecknadel im Heuhaufen!
90 % und mehr unserer Zeit verbringen wir heute in Innenräumen. Die Umgebungseinflüsse, die dabei auf unseren Körper einwirken, sind schon lange nicht mehr unbedenklich. Moderne Architektur und energiesparendes Bauen haben dazu geführt, daß unsere Häuser nur noch sehr wenig Frischluftaustausch mit der Außenluft haben. Damit können sich Schadstoffe, die aus Baumaterialien, Möbeln, Innenausstattungen oder durch unsere Aktivitäten – wie z.B. das Rauchen – freigesetzt werden, in der Raumluft anreichern. Diese Schadstoffe werden dann von unserem Körper aufgenommen, oft angereichert und führen dort zu Störungen, die sich meist unspezifisch durch eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens äußern. Ziel muß es also sein, insbesondere in Arbeitsstätten und Wohnräumen, in denen der Mensch Erholung von Arbeits- und Außeneinflüssen finden soll, Schadstoffe zu vermeiden oder so weit wie möglich zu reduzieren. Wichtig ist es dabei besonders, Schadstoffquellen, die bereits zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen, zu finden und zu beseitigen.
Diesem Ziel stehen aber eine Reihe von Tatsachen entgegen, denen auch wir uns als Sachverständige unterwerfen müssen:
- Die Zahl der heute in Innenräumen vorkommenden Schadstoffe und sonstigen Schadfaktoren ist sehr hoch und steigt ständig weiter. Auch die Zahl der möglichen Schadquellen ist sehr groß, so daß es oftmals nicht gelingt, alle möglichen Gegenstände, Einrichtungen oder Baumaterialien, aus denen Schadstoffe in den Innenraum gelangen, zu identifizieren und durch „schadstoffarme“ Produkte zu ersetzen.
- Das Erkennen von Schadstoffen erfordert oft eine aufwendige und teure Analytik. Selbst wenn ein bestimmter Stoff gefunden wird, der beispielsweise in höherer Konzentration auftritt als im Durchschnitt der Wohnungen, ist damit noch nicht gesagt, daß er auch für die Beschwerden verantwortlich ist. Außerdem: Auch in der modernen Analytik findet man nur die Stoffe, nach denen man sucht.
- Viele Menschen sind heute bereits mit schädlichen Stoffen hoch belastet oder genetisch empfindlich. Hier können bereits geringste Stoffkonzentrationen zur Krankheit führen - auch wenn diese weit unter der durchschnittlich gefunden oder als krankheitsauslösend bekannten Konzentrationsschwelle liegen.
- Selbst wenn Schadstoffquellen eindeutig als Auslöser für Befindlichkeitsstörungen oder Krankheiten erkannt werden ist es oft sehr teuer oder sogar unmöglich, alle Quellen zu verschließen oder zu beseitigen.
- Oft sind es nicht die Schadstoffe im Wohnbereich, die Beschwerden verursachen. Auch der Arbeitsplatz, das Auto, Hobbys, die Kleidung, die Ernährung oder andere Schadquellen in der Umgebung können dafür verantwortlich sein.
Befindlichkeitsstörungen? Wir raten zu einem Besuch beim Spezialisten, dem Umweltmediziner!
Liegen bereits Befindlichkeitsstörungen vor, ist es oftmals nicht möglich, die Ursache schnell zu finden, denn:
- die meisten Menschen sind heute einer Vielzahl von Schadfaktoren ausgesetzt, die alle zusammenwirken und damit den Menschen krank machen;
- die überwiegende Anzahl der Schadstoffe ruft keine ganz eindeutigen Leitsymptome hervor, so daß sich beispielsweise nicht eindeutig sagen läßt: „Dem Patienten tränen die Augen --> in seiner Wohnung befindet sich Formaldehyd in der Luft, das aus den Spanplatten des Schrankes stammt.“ Daher muss beim Auftreten von Beschwerden oftmals parallel zur Innenraumuntersuchung auch der Umweltmediziner aufgesucht werden – denn: zum Einen muß dieser andere Ursachen für die Erkrankung ausschließen, zum Anderen kann er Laboruntersuchungen in Blut, Serum oder Harn anordnen, um Schadstoffe direkt oder über deren typische Auswirkungen im Körper nachzuweisen.
Scheuen Sie daher diesen Arztbesuch nicht. Wir sind Ihnen gerne bei der Wahl eines kompetenten Umweltmediziners behilflich. Auch die Koordination von Raumuntersuchungen und die Probenahme sowie die Bewertung der Analysen sind Aufgaben des Toxikologen. Die Kosten für den Besuch eines zugelassenen Umweltmediziners und die Kosten für die von Ihm angeordneten Schadstoffmessungen in Körperflüssigkeiten oder Messung von typischen Stoffwechselveränderungen trägt oft die Krankenkasse. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen ersparen Ihnen unnötige Kosten für die Schadstoffsuche und Analyse.
Hausbau, Hauskauf, Schadstoffprobleme in der eigenen Immobilie? Gehen Sie kein Risiko ein!
Insbesondere beim Haus- oder Wohnungskauf einer älteren Immobilie ist es oft schwer, Aussagen über mögliche Schadstoffquellen zu treffen. Meist fehlt hier die Information über die verwendeten Materialien und Stoffe und darüber, wann diese Anwendung fanden. Auch sind viele Belastungen aus vorhergehenden Nutzungen nicht erkennbar. Die Menge der freigesetzten Schadstoffe und deren Auswirkungen auf Ihren Körper können jedoch auch noch nach Jahrzehnten erheblich sein. Hier kann der Sachverständige viele Erfahrungen einbringen, oft läßt es sich aber dennoch nicht vermeiden, analytische Schadstoffscreenings – also breitangelegte Suchaktionen – durchzuführen. Wir werden Ihnen gerne bei der Auswahl der Parameter und einer kostensparenden Analytik behilflich sein.
Auch hier gilt: so lassen sich viele Schadstoffbelastungen ausschließen, aber Schadstofffreiheit können auch wir als Berater nicht garantieren. Denn – wie bereits erwähnt
- kann man nur aus Bekanntem auf mögliche Schadstoffquellen schließen,
- sind noch lange nicht alle Umwelchemikalien bekannt und
- können in der Analytik nur solche Stoffe und Stoffgruppen gefunden werden, nach denen man sucht.
Ein umfassender „Toxikologischer Fingerabdruck“ eines Gebäudes ist heute zu erreichen – wir können Ihnen dabei helfen.
Gesundheitsgefahren durch Schadstoffbelastungen?
Gesundheitsgefährdende Stoffe in unseren Wohnungen und Büros? Nach dem Holzschutzmittelskandal der 80er Jahre und den Meldungen über Formaldehyd als Auslöser vieler Erkrankungen in den 90er Jahren, den Verboten von Asbest sowie von Polychlorierten Biphenylen (PCB) in den 70er und 80er Jahren oder dem Ersatz z.B. von Lösemitteln durch andere Stoffe gehen viele davon aus, dass in Innenräumen keine gesundheits-gefährdenden Belastungen mehr bestehen.
Die Praxis zeigt jedoch das Gegenteil:
Die Zahl von Allergien, Hauterkrankungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern nimmt stark zu. Erkrankungen im Zusammenhang mit Holzschutz- und Insektenschutzmitteln werden von Umweltmedizinern, Neurologen und Toxilogen weltweit als stark zunehmend eingestuft. Unfruchtbarkeit und hormonelle Störungen sind nach Studien in engem Zusammenhang mit der Belastung durch hormonanalog wirksame Umweltschadstoffe (Biozide, Weichmacher, Flammschutzmittel, synthetische Duftstoffe) zu sehen.
Weltweit befinden sich derzeit ca. 100.000 chemische Substanzen in Anwendung durch den Menschen und ca. 2.000 – 3.000 „neue Verbindungen“ kommen pro Jahr hinzu. Wo noch vor 15 Jahren ca. 1.000 – 1.500 chemische Verbindungen in Innenräumen nachzuweisen waren, treten heute mit den gleichen Messverfahren ca. 3.000 – 4.000 Verbindungen auf.
Viele davon gehören dabei zu den seit langem verbotenen Substanzen, denn die meisten – z.B. Holzschutzmittel-Wirkstoffe oder Weichmacher aus der Gruppe der PCB – sind extrem langlebig und bei weitem nicht alle Quellen sind beseitigt. Oft werden diese Stoffe mit Importwaren aus Entwicklungsländern in massiven Konzentrationen eingeführt. Alte Bekannte wie das Insektenvernichtungsmittel DDT tauchen aus diesem Grund als Teppich-ausrüstung oder in „Antiquitäten“ wieder häufiger auf.
Als formaldehydemissionsarm (E1) gekennzeichnete Spanplatten halten keineswegs ebenfalls nicht immer was sie versprechen. Viele sind belastet. Wer sicher gehen will, sollte Spanplatten der Klasse E0 verwenden.
Häufig verwendig werden auch die problematischen Pthalate, die als Weichmacher z.B. in PVC und Vinyltapeten, aber auch in vielen anderen Kunststoffen zu finden sind. Sie wirken immunsuppressiv, kanzerogen und beeinflussen das Hormonsystem.
Die Symptome, die bei Belastungen mit Innenraumschadstoffen auftreten können, sind so vielfältig wie die Substanzen. Neben akuten Reizbeschwerden wie Kopfschmerz, Reizungen von Augen und Schleimhäuten, Husten- oder Niesreiz, Kratzen im Hals oder Hautrötungen können chronische Infekte, Asthma, Hautprobleme wie Neurodermitis oder seborrohisches Ekzem Anzeichen von Belastungen sein. Häufig treten diffuse Symptome, wie chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Depressionen, aber auch Einschränkungen der kognitiven Fähigkeiten wie Gedächtnis- oder Konzentrationsstörungen bis hin zu Unruhe, Agressivität oder anderen Verhaltensänderungen auf.
Hinweise auf innenraumbedingte Belastungen können sein:
Besserung der Beschwerden nach längerem Aufenthalt außerhalb der Räume und Wiederauftreten nach Rückkehr, zeitlicher Zusammenhang mit Veränderungen im Wohn- oder Arbeitsumfeld, Fehlen klassischer klinischer Ursachen für die Beschwerden oder Resistenz gegen klassische Therapien oder schleichende Verschlimmerung, oder das Hinzukommen weiterer Symptome.
Dabei ist das Auftreten von Symptomen stark von der individuellen Konstitution des Einzelnen abhängig. Vorbelastungen spielen ebenso eine Rolle, wie die genetisch bedingte Fähigkeit des Einzelnen, Fremdstoffe, die in den Körper gelangen, zu entgiften und auszuscheiden. Auch die Expositionszeit spielt eine große Rolle. Häufig sind es Hausfrauen, die bei Wohnungsbelastungen aufgrund ihres meist ganztägigen Aufenthaltes und intensiveren Kontaktes mit Schadstoffen frühere oder stärkere Symptome äußern, als andere Familienmitglieder.
Bei gesundheitlichen Problemen, präventiv vor dem Bezug einer neuen Wohnung, bei Wohnungs- oder Hauserwerb oder wenn Kleinkinder in die Familie kommen: Erfahrene Spezialisten für Innenraumbelastungen und Innenraumtoxikologie können Ihnen – oft in enger Zusammenarbeit mit Umweltmedizinern und anderen Fachärzten - weiterhelfen.
Dabei ist es oft unnötig oder nur in kleinem Umfang erforderlich, teure Analytik durchzuführen. Eine genaue Bestandsaufnahme möglicher Emissionsquellen vor Ort und eine genaue Untersuchung der gesundheitlichen Beschwerden aber auch der Expositionssituation am Arbeitsplatz und in der persönlichen Lebensgeschichte ermöglichen es meist, die Belastungsquellen einzugrenzen, gezielt zu untersuchen und zu vermeiden oder zu sanieren. Neben einer fachgerechten und toxikologisch sicheren Beseitigung der Belastungsquellen sollte sich möglicherweise auch eine umweltmedizinische Behandlung von Betroffenen anschließen.
Information als PDF-Download:
Gesundheitsgefahren durch Schadstoffbelastungen?
Information zu Dichlordiphenl-trichlorethan (DDT)
1) Verwendung und mögliche Quellen für DDT:
- Insektenvernichtungsmittel (Insektizid) mit breitem Wirkungsspektrum
- war Bestandteil von Holzschutzmitteln
- wurde und wird als Fraßschutz z.B. bei Stoffen und Textilien eingesetzt
- ist in den alten Bundesländern seit 1972, in den neuen Bundesländern seit Mitte 1991 verboten
2) Aufnahme
durch den Magendarmtrakt, die Lunge, die Haut
3) Speicherung
DDT weist nur sehr geringe biologische Abbaubarkeit auf. Es wird im Körperfett, in der Muttermilch und in der Blut-Proteinfraktion angereichert. Im Körper erfolgt ein langsamer Abbau zu DDE (1,1-Dichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)-ethen), das sich hauptsächlich im Blut findet, zu DDD (1,1-Dichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)-ethan) und DDA (2,2-bis (4-chlorophenyl)-essigsäure), das als Abbauprodukt im Harn nachgewiesen werden kann. Im Stuhl werden DDT und DDE ausgeschieden.
4) Mögliche Symptome:
Bei akuter Belastung können Erregung, Zittern, Krämpfe und Bewegungsstörungen auftreten. Blutdruckabfall, Benommenheit und Kopfschmerzen sind ebenfalls bei Belastung mit hohen Dosen zu beobachten. Bei Lanzeitbelastung mit geringeren Konzentrationen können die Krankheitsbilder des sogenannten CKW (Chlorierte-Kohlenwasserstoff-)-Syndroms auftreten, die meist auf eine Beeinträchtigung des Nervensystems und des Immunsystems beruhen:
- Kopfschmerzen, Unwohlsein, Konzentrationsstörungen, vermehrte Müdigkeit, Schlafstörungen, Schwindel
- Psychiatrisch: schnelle Ermüdbarkeit. Mattigkeit, Reizbarkeit, Affektlabilität, Aggressivität, Konzentrationsstörungen, Störungen im Kurzzeitgedächtnis, innere Unruhe, Schlafstörungen, Potenz- und Libidostörungen
- Internistisch: Harnwegs- und Nasen-Rachenrauminfekte, Rachenschleimhaut- und Mandelrötungen, Bronchitis, Bronchialasthma, Pseudokrupp, Pilzinfektionen des Darmbereiches, Milz- und Lymphknotenschäden, Nieren- und Lebererkrankungen
- Hormonell: Zyklusstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen, Sterilität, Schwangerschaftsabbrüche, verstärkte Körperbehaarung bei Frauen, Haarausfall, Schilddrüsenstörungen
- Neurologisch: Sensibilitätsstörungen und Ãœberempfindlichkeiten, Nervenschwächen, Sensibilitätsstörungen der Extremitäten, Hirnstörungen, Sehstörungen
- Dermatologisch: Clorakne, Neigung zu Pilzinfektionen der Haut, Haarausfall
Möglicherweise löst DDT beim Menschen Krebs aus!
5) Normalwerte
DDT-Table
6) Grenzwerte
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte:
MAK (Max. Arbeitsplatzkonzentration): 1 mg/m³ Luft
TVO (Grenzwert nach Trinkwasserverordnung): 0,1 µg/l
ADI (Acceptable dayly intake): 5 µg/kg/d
nach IARC (International Ageny for Research in Cancer) ist DDT als Gruppe 2B: eventuell kanzerogen am Menschen eingestuft
Information als PDF-Download:
Dichlordiphenl-trichlorethan (DDT)

| Medium | Richtwerte | gemessen: |
|---|---|---|
| Blut | < 2,5 µg/l | DDT+DDE |
| Fettgewebe | < 92 µg/kg | DDT |
| Fettgewebe | < 900 µg/kg | DDT |
| Holz | < 1 mg | DDT |
| Hausstaub | < 1mg/kg | DDT |
| Feststoffe | < 1mg/kg | DDT |
| Luft | MAK = 1 mg/kg | DDT |
| Muttermilch | < 1,51 mg/kg | DDE+DDT |
| Trinkwasser | < 0,1 µg/l TVO | DDT |
Flammschutzmittel
1) Mögliche Quellen für Flammschutzmittel:
Textilien, Montageschäume und andere Schaumkunststoffe, Decken- und Wandverkleidungsplatten auf Faserbasis, Kunststoffe in Bodenbelägen, Elektrogeräten, Möbeln etc.
2) Stoffe
- Trisphosphate: TCEP (Tris-(Chlorethyl)-phosphat, TCIPP (Tris-(1,3-dichlorisopropyl)phosphat, TCPP (Tris-(1,3-dichloropropyl)phosphat
- Polybromierte Diphenylether (PBDPE)
- Metalle (Arsen, Aluminium, Antimon)
- Polychlorierte Biphenyle (PCB)
3) Mögliche Symptome:
Über gesundheitliche Auswirkungen dieser Stoffe liegen nur wenige Erkenntnisse vor. Bei einigen ist im Tierversuch ein krebserzeugendes Potential nachgewiesen worden (TCEP). Man vermutet Zusammenhänge mit Beschwerden des sog. Sick-Building-Syndroms. Die Phosphate sind aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften potentiell bei chronischer Exposition schädlich für Nerven- und Immunsystem.
Belastungen mit Flammschutzmitteln u.a. Innenraumschadstoffen werden mit einer Überlastung des körpereigenen Entgiftungssystems sowie der Erschöpfung notwendiger Cofaktoren, wie es bei „Umweltpatienten“ und Allergikern häufig beobachtet wird, in Verbindung gebracht. Gleiches gilt für die Gruppe der Weichmacher.
Organische Flammschutzmittel und Weichmacher stehen im Verdacht, hormonartige Wirkungen im menschlichen Körper zu besitzen und damit für Zyklusstörungen, Unfruchtbarkeit u.ä. mitverantwortlich zu sein.
Aluminium wird des Weiteren im Zusammenhang mit der Alzheimer-Erkrankung als Ursache diskutiert.
4) Grenzwerte
Es gibt für den Wohnraumbereich keine Grenz- oder Richtwerte. Daten über durchschnittliche Wohnungsbelastungen fehlen noch.
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte:
TCEP: krebserzeugend Kl. 3, (begründeter Verdacht auf ...), Fortpflanzungsgefährdend Kl. RF3 (Besorgnis der Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit), Spitzenbegrenzung I, S, C
Information als PDF-Download:
Flammschutzmittel

Formaldehyd
Synonym: Formalin, Formol (Lösungen), Formylhydrat, Methanal
1) Mögliche Quellen
Harnstoff-Formaldehydharze (UF): geben leicht Formaldehyd ab, sind nicht lebensmittelgeeignet und nicht feuchtefest, kommen vor in Pressmassen Elektro/Sanitär, Holzleimen für Spanplatten, säurehärtenden Lacken für Möbel-, Parkett-, Dielenversiegelung, Einbrennlacken, Ortsschäumen
Melamin-Formaldehydharze (MF): Bindemittel in Küchen-/ Schlafzimmermöbeln
Amino- und Phenoplaste (PF) und Kresolformaldehydharze (CF): verkohlen unter Phenolfreisetzung, kommen vor in Beschlägen, diversen Bindemitteln, Phenolharzleimen/-klebern, Schaumstoffen
Resorcin-Formaldehyd-Harze (RF): sind beständig, d.h. unter Normalbedingungen keine Formaldehydabgabe
Polyoxymethylen (POM): relativ beständig, d.h. unter Normalbedingungen keine Formaldehydabgabe, Vorkommen in Beschlägen, Armaturen, Formteilen, Folien
Weitere mögliche Formaldehyd-Quellen: Verbrennungsprozesse – insbesondere das Rauchen – aber auch:
Farbstoffe, Aromastoffe, Pestizide, Düngemittel, Textilien („knitterfrei“, „pflegeleicht“), Leder (Gerbbrühe), Papier („wasserfest“), Kosmetika (Konservierung), Nahrung (Konservierung von Öl und Fett, Trockennahrung, Modifikator von Stärke, in künstlichen Därmen), Haushaltschemikalien, Reduktionsmittel (z.B. verwendet in der Spiegelherstellung), Textilindustrie (Wollfaserschutz), Desinfektions- und Konservierungsmittel ... .
2) Mögliche Symptome:
Formaldehyd und andere kurzkettige Aldehyde wie Acetaldehyd oder Acrolein führen zu Reizungen oder Verätzung von Schleimhäute und oberen Luftwege. Sie schwächen die Immunabwehr und äußern sich in Allergien (Typ 1 Allergie (IgE-vermittelt), Typ IV (zellvermittelt, Tuberkulintyp)), Bindehautentzündungen, Kontaktdermatitiden, Entzündungen von Kehlkopf-, Mund-, Nasen- und Rachenschleimhäuten, Nervenstörungen, Schwindel oder Schläfrigkeit. Bei akuten Vergiftungen können Lungenödem, Leberschäden (insbesondere durch Acetaldehyd), Nierenschäden sowie Schäden des Nervensystems auftreten.
Laut WHO können Formaldehyd und Acetaldehyd Krebs erzeugen!
3) So wirken verschiedene Formaldehydkonzentrationen
Bei Einatmen (1 ppm = 1,25 mg = 1 ml Formaldehyd pro m³ Luft ):
0,01 – 1,6 ppm: Schleimhaut- und lokale Reizungen
2 – 3 ppm: Stechen in Nase, Augen, Rachen
4 – 5 ppm: Unbehagen, Tränenfluss
10 – 22 ppm: starker Tränenfluß, Dyspnoe, Husten, Brennen in Nase, Augen, Kehle
30 ppm: Lebensgefahr, toxisches Lungenoedem, Pneumonie. Die Wahrnehmungsgrenze liegt bei 1 ppm.
4) Grenzwerte
Es gibt für den Wohnraumbereich einen Empfehlungswert des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes von 0,1 ppm = 0,12 mg pro m³ Luft. Allergiker oder empfindliche Personen können jedoch bereits bei geringeren Konzentrationen deutliche Symptome zeigen.
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte:
MAK 0,5 ppm (0,6 mg/m³) III B, (begründeter Verdacht auf ...) Spitzenbegrenzung I, S, C
MIK Dauer = 0,02 ppm, Kurzzeit = 0,06 ppm
5) Kennzeichnungspflicht:
In Wasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln: ab 0,1 %,
in Textilien: > 0,15 %,
in Kosmetika: > 0,05 %,
Holzwerkstoffe, die im Ausgasungsversuch ab 0,1 ppm Formaldehyd freisetzen, sind verboten. Spanplatten werden wie folgt gekennzeichnet:
Tabelle: Kennzeichnung von Spanplatten:
Spanplatten-Table
6) Formaldehyd im Hausstaub/Raumluft:
Richtgrenze für die Hausstaubkonzentration: 50 mg/kg
Es gelten
10 mg/kg für Wohnräume als unbedenklich,
> 10 mg/kg kann zu allergischen Reaktionen führen,
> 30 mg/kg bedenklich für vorgeschädigte Personen,
> 60 mg/kg kann zu schweren chronischen Leiden führen,
> 90 mg/kg führt zu irreversiblen Schädigungen der Gesundheit.
Information als PDF-Download:
Formaldehyd

| Klasse/Kennzeichnung | Formaldehydfreisetzung Perforator in mg/100g | Formaldehydfreisetzung Immissionswert in ppm | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| E0 | --- | --- | --- |
| E1 | 10 | < 0,1 | keine Beschichtung erforderlich |
| E2 | 10 bis 30 | 0,1 bis 1,0 | Beschichtung bei einer Fläche > 0,8 m² |
| E3 | > 30 | > 1,0 bis 2,3 | Beschichtung der Ober- und Schmalflächen |
Hexachlorbenzol (HCB)
Synonym: Perchlorbenzol
1) Verwendung und mögliche Quellen für HCB:
Hexachlorbenzol gehört wie das DDT, Lindan oder Pentachlorphenol zu den halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen. Hexachlorbenzol wurde als Pilzgift (Fungizid) eingesetzt. Es fand Verwendung in der Saatgutbehandlung, in Holzschutzmitteln und als Zusatzstoff für PVC (Polyvinylchlorid, z.B. als Bodenbelag), Isolationsmaterialien oder Klebstoffe. Hexachlorbenzol entsteht auch als Nebenprodukt bei der Kunststoff- und Lösemittelherstellung. Die Anwendung als Pflanzenschutzmittel ist in Deutschland verboten. Der Einsatz erfolgte bis Mitte der 70er Jahre. Bedingt durch den großflächigen Einsatz in der Landwirtschaft, die relativ hohe Flüchtigkeit und den langsamen Abbau im Organismus (biologische Halbwertzeit ca. 3 Jahre) ist HCB heute in der ganzen belebten Umwelt (Biosphäre) zu finden.
2) Aufnahme:
durch den Magendarmtrakt, die Lunge, die Haut. Wie andere chlorierte Stoffe (das Pilzgift in Holzschutzmitteln Pentachlorphenol (PCP) oder die Weichmacher PCB (Polychlorierte Biphenyle) wird ein Teil des HCB über Nahrungsmittel und Trinkwasser aufgenommen.
3) Speicherung
Wie andere Organochlor-Pestizide wird HCB vorwiegend in Fettgeweben gespeichert. Es gelangt auch in die Muttermilch. Säuglinge sind besonders gefährdet.
4) Mögliche Symptome:
HCB weist in den meisten Fällen wie das Pilzgift Pentachlorphenol (PCP) Verunreinigungen mit Dioxinen und Furanen auf. Diese sind in der Wirkung ebenfalls zu berücksichtigen. Bei akuter Belastung können Chlorakne und akute Vergiftungserscheinungen wie Ãœbelkeit, Erbrechen, Taubheit der Extremitäten und Haarausfall auftreten. Akute Symptome treten erst bei sehr hohen Konzentrationen auf. Des Weiteren kann beim biologischen Abbau von HCB das Pilzgift Pentachlorphenol (PCP) entstehen.
Bei Langzeitbelastung mit geringeren Konzentrationen – im Körper kann es zu einer Aufkonzentrierung in fetthaltigen Geweben kommen – sind folgende Symptome beschrieben:
- Schleimhautreizungen,
- erhöhte Hautpigemntierung,
- Blasenbildung der Haut,
- Leberschädigungen, Lebervergrößerungen,
- Poryphyrie (Störung der Biosynthese des roten Blutfarbstoffes u.a. in der Leber),
- Muskelschuwnd oder Arthritis,
- im Tierversuch krebserregend und fruchtschädigend
Möglicherweise löst HCB beim Menschen Krebs aus!
5) Normalwerte:
tabelle-normalwerte
6) Grenzwerte:
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte: BAT (Biologischer Arbeitsstoff-Toleranzwert) = 150 µg/l Blutplasma/Serum
Information als PDF-Download:
Hexachlorbenzol
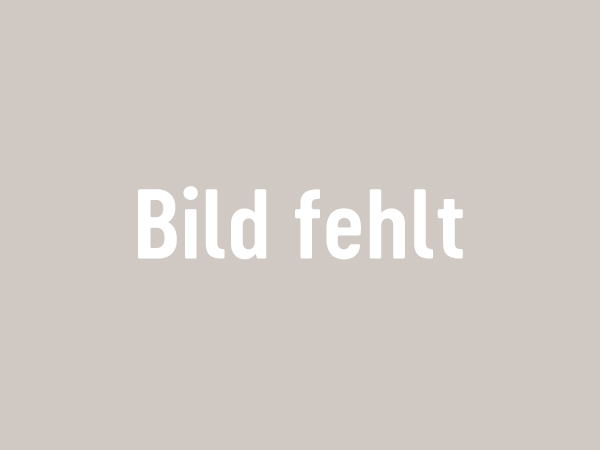
| Medium | Richtwerte |
|---|---|
| Blut | < 1,2 µg/l // < 1 µg/l |
| Fettgewebe | < 460 µg/kg |
| Hausstaub | < 1 mg/kg |
| Feststoffe | < 1 mg/kg |
| Luft | MAK = 0,5 – 1 mg/m³ |
| Muttermilch | < 1,05 mg/kg |
| Trinkwasser | < 2 µg/l |
Häufige Holz-/Textilschutzmittel
Pentachlorphenol (PCP, Chlorophen)
ist ein Pilzgift (Fungizid). Es wurde insbesondere im Holzschutz, in den 60er und 70er Jahren besonders auch im Innenraumbereich, eingesetzt. 1986 erfolgten in Deutschland im Rahmen der Neufassung der Gefahrstoffverordnung erste Einschränkungen für PCP in der Verwendung. PCP ist in Deutschland seit 1989 in der Anwendung verboten. Auch im Reis-, Zuckerrohr-, Ananas- und Baumwollanbau wird PCP verwendet. Weiterhin wird es eingesetzt in Klebern, Leimen, in der Textil- und Papierindustrie sowie zur Behandlung von Pelzen und Leder. Darüber hinaus ist es in einigen Kunststoffen zu finden (z.B. bei Badezimmerschränken von Alibert).
Die Aufnahme findet über die Haut, die Nahrung und die Atemwege statt. Es wird in der Leber und im Fettgewebe gespeichert und lagert sich an Körpereiweiße an. Probleme bereiten auch die meist im PCP enthaltenen Verunreinigungen wie die hochgiftigen Dioxine und Furane.
PCP kann bei akuter Vergiftung zu Schwindelgefühlen, Mattigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Krämpfen, Durstgefühl, Übelkeit, Schwitzen, Erbrechen, Durchfall und Fieber führen. Die stoffwechselstörende Eigenschaft des PCP („Entkopplung“) kann zu Kurzatmigkeit, Herzjagen und extremem Fieber führen.
Chronische Vergiftungen äußern sich durch Nerven- und Gelenkschmerzen, Hautausschläge und akneförmige Hautveränderungen, Blutdruckstörungen, Herzmuskelentzündung, und Leberfunktionsstörungen. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Haut- und Schleimhautreizungen und Veränderungen im Blutbild können auftreten. Langzeitschädigungen der Augen- oder Nasenschleimhäute sind oft Folge von Kontakt mit PCP-belastetem Hausstaub. Leberschäden sind beschrieben. PCP wirkt außerdem Hormonanalog und Immunsuppressiv. PCP gilt als einer der Verursacher des sogenannten Holzschutzmittelsyndroms:
Symptome hierfür sind Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Unverträglichkeit von Kaffee und Alkohol, Gleichgewichts- und Herzrhythmusstörungen, Schwitzen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, Haarausfall, Temperaturerhöhung, Leberfunktionsstörungen, Blutbildveränderungen, Zerschlagenheit, Depressionen, Gewichtsabnahme oder Muskel- und Gelenkschmerzen. In der Literatur wird häufig auch das Chlorkohlenwasserstoff-(CKW-)syndrom beschrieben (s.u.).PCP ist als eindeutig krebserregend (Blutkrebs, Weichteilsarkome) MAK-Liste A III A2 eingestuft.
„Normalwerte“ im Hausstaub sind z. Zt. für Deutschland mit < 5 mg/kg Hausstaub angegeben. Der Richtwert des ehemaligen Bundesgesundheitsministeriums beträgt 1 µg/m³ Raumluft. Vom Verband deutscher Ingenieure VDI wird bei einer Raumluftkonzentration von 0,1 µg/m³ eine langfristige ab 0,25 µg/m³ eine sofortige Sanierung angeraten.
Hexachlorcyclohexan (HCH)
Bei der Produktion des Pflanzenschutzmittels „Lindan“ = g-HCH (gamma-HCH entsteht ein Gemisch aus a-, b- und g-HCH. Nur ca. 15 % des Gemisches bestehen aus dem Insektengift g-HCH. 85 % sind a- und b- HCH. Besonders b-HCH erwies sich in Tierversuchen als hochtoxisch! Dieses technische Stoffgemisch ist heute in den Industriestaaten verboten. Gereinigtes Lindan (g-HCH) findet jedoch teilweise noch Verwendung. 1983 haben sich Holzschutzmittelhersteller in Absprache mit dem Gesundheitsministerium und dem damaligen Bundesgesundheitsamt bereit erklärt, nur noch 99,7 % reines Lindan einzusetzen. Lindan wurde und wird z.T. noch eingesetzt als Insektenvernichtungsmittel in Saatgutbeize, Holzschutzmitteln, Läusebekämpfungsmitteln und zur Insektenbekämpfung bei Haus- und Nutztieren sowie in vielen Insektensprays und -streifen.
Die Aufnahme erfolgt über Haut, Lunge und Magen-Darm-Trakt. Es wird bevorzugt in Fettgeweben gespeichert und reichert sich dort an. Leber und Niere gelten ebenfalls als Speicher. Lindan reichert sich in der Muttermilch an.
Bei akuter Vergiftung treten Kopfschmerzen, Zittern, Benommenheit, Krämpfe neben Bewegungsstörungen, Blutdruckabfall, Erregbarkeit auf. Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Lähmungen und Fieber bis zum Koma können auftreten
Bei chronischer Vergiftung sind Schwäche, Appetitlosigkeit, Leber- und Knochenmarkschädigungen (es resultiert Immunschwäche), Beschwerden im Magen-Darm-Trakt, Schlafstörungen sowie Herzrhythmusstörungen als Symptome beschrieben. Wahrscheinlich kann HCH beim Menschen Krebs erzeugen.
In der Literatur wird häufig auch das Chlorkohlenwasserstoff-(CKW-)Syndrom beschrieben (s.u.).
„Normalwerte“ im Hausstaub für g-HCH betragen bis zu 3 mg/kg. Am Arbeitsplatz darf die Konzentration bis 0,5 mg/m³ (Maximale Arbeitsplatzkonzentration, MAK-Wert) betragen. Die maximale Immissionskonzentration (MIK) beträgt 0,03 mg. Die maximal duldbare Raumluftkonzentration wird z.Zt. mit 0,004 mg/m³ angegeben.
Permethrin
ist ein Vertreter der Pyrethroide. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe künstlich hergestellter Insektizide, die alle auf dem Grundgerüst des natürlichen Wirkstoffs in Chrysanthemen, Pyrethrum, basieren. Permethrin gehört zu den Langzeitpyrethroiden. Diese dienen als Insektengifte mit Kontakt- oder Fraßgiftwirkung. Sie werden verwendet in Holzschutzmitteln, Insektenvernichtungsmitteln (Spritzmitteln für Zimmerpflanzen, Insektensprays, Insektenschutz-Verdampferblättchen, Lockstofffallen) sowie als Eulanisierungsmittel (Mottenschutz für Wolle, Federn, Haare; Teppiche mit Wollsiegel müssen mit einem Eulanisierungsmittel behandelt sein). Permethrin wird weiterhin eingesetzt als Milben- und Läusebekämpfungsmittel sowie gegen Nemathoden.
Aufgenommen werden Pyrethroide über den Magen-Darmtrakt, die Haut und den Atmungstrakt. Pyrethroide sind nur wenig flüchtig. Nur Elektroverdampfer führen zu hohen Konzentrationen in der Raumluft. Wichtigste Aufnahmequelle ist der Hausstaub.
Pyrethroide sind unter Innenraumbedingungen sehr stabil. Bei Temperaturen bis zu 40 °C ist Permethrin bis zu zwei Jahren stabil. Im Körper wird es jedoch schnell abgebaut. Es gibt Hinweise, daß diese Substanzen sich in Fettgeweben, Nerven und Gehirn anreichern.
Akut giftig sind diese Substanzen erst in höheren Konzentrationen. Haut- und Schleimhautreizungen, Kopfschmerz, Müdigkeit, Schwindel, Schweißausbrüche, Herzjagen, Niedergeschlagenheit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle Krämpfe bis hin zu Bewußtseinsstörungen oder Koma können bei akuter Vergiftung auftreten.
Chronische Symptome - nach längerer Aufnahme z.T. geringer Mengen und Anreicherung im Körper - sind umstritten. Beeinträchtigung der intellektuellen Leistungsfähigkeit mit Konzentrationsschwächen, Gedächtnisstörungen, Wortfindungsstörungen, Silbenverdrehung beim Sprechen, Verwirrtheit, Durchblutungsstörungen, Antriebs- und Motivationsverlust oder Depressionen können Folge einer Intoxikation mit Pyrethroiden sein.
Diese Stoffe wirken zum einen auf die Nervenzellen, wo sie die Nervenleitung beeinflussen. Ein krebsauslösende und Immunsystem-schädigende Wirkung ist auf der anderen Seite bei einigen dieser Substanzen nachgewiesen. Die amerikanische Umweltbehörde EPA führt z.Zt. Studien durch. Permethrin ist zur Zeit eingestuft als „im Verdacht auf tumorerzeugende Wirkung“.
Die „Normalwerte“ für Permethrin in Hausstaub sind mit < 1 mg/kg angegeben. Hier ist davon auszugehen, daß keine Belastung über die durchschnittliche Grundbelastung durch die Außenluft vorliegt. Gesetzliche Innenraumgrenz- oder -richtwerte liegen noch nicht vor.
Eine Untersuchung des Bremer Umweltinstituts (1988) empfiehlt für die Hausstaubbelastung folgende Bewertungs-Staffel:
bis 3 mg / kg > geringe Belastung
3 bis 30 mg / kg > deutliche Belastung
30 bis 100 mg / kg > hohe Belastung
über 100 mg / kg > sehr hohe Belastung
Chlorkohlenwasserstoff-(CKW-)Syndrom:
(nach Huber et.al. Klin. Lab. 1992 (38) 456-461 und Schwinger, G. Mitteilungen IV der IHG 1991 16-18 aus Schiwara et.al., Bremen, Umweltmedizinische Analysen 5. Auflage, Selbstverlag)
Allgemein:
Kopfschmerzen, Unwohlsein, Konzentrationsstörungen, vermehrte Müdigkeit, Schlafstörungen, Schwindel
Psychiatrisch:
schnelle Ermüdbarkeit, Mattigkeit, Reizbarkeit, Affektlabilität, Aggressivität, Störungen von Konzentration und Kurzzeitgedächtnis, innere Unruhe, Schlafstörungen, Libidoreduktion
Internistisch / immunologisch:
Harnwegs- und Nasen-/Rachenrauminfekte, Rachenschleimhaut- und Tonsillenrötung, Bronchitis, Asthma bronch., Pseudo-Krupp, rezidivierende Pilzerkrankungen des Darms, Milz- und Lymphknotenschäden, Nierenfunktionsstörungen, Lebererkrankungen
Hormonell:
Zyklusstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen, primäre Sterilität, habituelle Aborte, übermäßige Behaarung (Hirsutismus), Vermännlichung (Androgeniesierung), Haarausfall, Schilddrüsenstörungen
Neurologisch:
Schmerzüberempfindlichkeit (Hyperästhesie), Nervenschwäche (Neurasthenie), Nervenerkrankungen (Polyneurophathie), hirnorganische Befunde, Sehstörungen, Fehlempfindungen des Tastsinns (Parästhesien)
Dermatologisch:
Akne / Chlorakne, Mykoseneigung, Haarausfall
Information als PDF-Download:
Holzschutz-/Textilschutzmittel
Isocyanate
Beispiele: TDI (Toluylendiisocyanat = Diisocyanattoluol), MDI (Diphenylmethan- diisocyanat), HDI (Hexamethylendiisocyanat) oder NDI (Naphthylen-diisocyanat)
1) Mögliche Quellen für Isocyanate:
Polyurethane
sind heute vielfach eingesetzte Kunststoffe – insbesondere im Baubereich. Es handelt sich um Polymere Verbindungen mit hohem Molekulargewicht, die aus der Polymerisation von kleinen Molekülen entstehen. Isocyanate (Verbindungen mit einer R - N = C = O Gruppe) und mehrwertige Alkohole werden hierbei als Ausgangsprodukte verwendet. Isocyanate sind hochtoxisch und es können krebserregende aromatische Amine entstehen.
Polyurethane – und damit auch Reste der Ausgangsstoffe Isocyanate – finden sich
z.B. in:
- formaldehydfreien Spanplatten
- Lacken
- Klebstoffen
- Leimen
- synthetischem Kautschuk (z.B. Schuhsohlen)
- Faserstoffen
- Isolationsmaterial für Elektrokabel
- Schaumstoffen für Polstermaterialien
- Matratzen
- Kissen
- Wärmeisolation für Winterkleidung
- Hohlräumen- und Montageschäumen
- Dämmplatten
Dabei werden ca. 21 % in der Möbelindustrie, der Rest vorwiegend in der Automobil- und Bauindustrie verwendet. Probleme bereitet, dass
- die Ausgangsstoffe für diese Reaktionen und damit auch die Isocyanate nie vollständig reagieren
- aus polymerisierten Polyurethanen sich die Ausgangsprodukte und damit die Isocyanate zurückbilden können
- bei der Verarbeitung der Isocyanate viele Menschen belastet werden.
2) Aufnahme in den Körper
Die Aufnahme geschieht überwiegend über die Lunge.
3) Mögliche Symptome:
Die reaktiven Isocyanate reagieren mit vielen Molekülen im Körper. Daher kann es zu unterschiedlichen Krankheitsbildern kommen. Neben äußerst seltenen Kontaktreaktionen der Haut kommt es insbesondere im Atmungstrakt zu
- Toxischen Irritationen, d.h. Reizungen durch Schädigung der Schleimhautzellen, die sich in Husten, Niesen, Kratzen und Halsschmerzen, vermehrtem Schleimfluss (Fließschnupfen) oder Tränenfluss äußern. Diese Symptome treten bei Luftkonzentrationen von 50 ppb (parts per billion = hier ca. 350 µg/m³ Luft) ab 30 Minuten Einwirkdauer auf.
- Spezifischen Überempfindlichkeiten. Diese treten bei ca. 20 % der Menschen auf, die mit Isocyanaten häufig in Konzentrationen über ca. 20 ppb in Kontakt kommen. Neben asthmatischen Reaktionen können hier grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Brustbeklemmung, Atemnot, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Nach Sensibilisierung können diese Reaktionen bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen auftreten.
- Unspezifische bronchialer Hyperreaktivität. Personen mit Unspezifischer bronchialer Hyperreaktivität (UBH) (= unspezifische Überempfindlichkeit) (ca. 15-20% der Bevölkerung) reagieren ebenfalls bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen verschiedenster physikalischer und chemischer Reizstoffe. Isocyanate sind im Verdacht Mitauslöser einer UBH zu sein.
Die krebsauslösende Wirkung wird z.Zt. geprüft. Im Tierversuch haben sich Isocyanate als gentoxisch und krebserregend erwiesen.
4) Grenzwerte:
Es gibt für den Wohnraumbereich keinen Empfehlungswert für die Raumluftbelastung mit Isocyanaten. Allergiker oder empfindliche Personen können jedoch bereits bei geringsten Konzentrationen deutliche Symptome zeigen.
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte:
MAK 0,01 ppm (70 µg/m³) Spitzenbegrenzung I, S (Sensibilisierend)
Information als PDF-Download:
Isocyanate

Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Synonym: z.B. Clophen, Arochlor, Kanechlor, Phenochlor
1) Verwendung und mögliche Quellen für PCB’s:
PCB’s gehören wie das DDT, Lindan oder Pentachlorphenol zu den halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen. Polychlorierte Biphenyle (PCB) ist die Sammelbezeichnung für eine chemische Stoffgruppe, die seit 1929 aufgrund ihrer vielseitigen technischen Eigenschaften in großen Mengen weltweit industriell hergestellt wurde.
Bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts galt die Verwendung von PCB als gesundheitlich unbedenklich. 1968 kam es in Japan zu einer Massenerkrankung durch PCB-belastetes Speiseöl. Die Verwendung von PCB wurde danach zunehmend beschränkt. Es begannen Forschungen über die Verbreitung von PCB in der Umwelt und in der menschlichen Nahrungskette sowie über die chronische Giftigkeit von PCB. Seit 1989 dürfen nach internationalen Vereinbarungen PCB und PCB-haltige Produkte und Geräte in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr hergestellt, importiert, exportiert oder verkauft werden. Dennoch sind PCB´s auch heute noch überall zu finden: In der Luft, in Gewässern und im Boden.
Vorkommen von PCB´s:
- Weichmacher für Kunststoffe, dauerelastische Fugenmassen (Thiocol), Kitte, Klebstoffe
- Hydrauliköle, Schalöle
- Isolator in Kondensatoren und Transformationen z.B. in Elektrogeräten, Leuchtstoffröhren, Motoren
- Zusatz in Papier, Wachsen,...
- Zusatz in Farben
- Flammschutzmittel für Kunststoffe, Hölzer
2) Aufnahme:
durch den Magendarmtrakt, die Lunge, die Haut.
3) Speicherung
Wie andere Pestizide werden PCB’s vorwiegend in Fettgeweben gespeichert. Sie gelangen auch in die Muttermilch. Säuglinge sind besonders gefährdet.
4) Mögliche Symptome:
PCB’s weisen in den meisten Fällen Verunreinigungen mit Dioxinen und Furanen auf. Diese sind in der Wirkung ebenfalls zu berücksichtigen. Bei akuter Belastung können Chlorakne und akute Vergiftungserscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Taubheit der Extremitäten und Haarausfall auftreten. Akute Symptome treten erst bei sehr hohen Konzentrationen auf.
Bei Langzeitbelastung mit geringeren Konzentrationen – im Körper kann es zu einer Aufkonzentrierung in fetthaltigen Geweben kommen – sind folgende Symptome beschrieben:
- Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Störungen des Sehvermögens, Störungen des Hörvermögens, allgemeine Schwäche
- Herz-Kreislauferkrankungen
- Hirnstoffwechselstörungen mit Erscheinungen wie Wortschatzeinschränkungen, Vergesslichkeit, Blackouts
- Störungen im peripheren Nervensystem wie Gefühllosigkeit oder Kribbeln in Armen und Beinen
tabelle-polychlorierte-biphenyle
6) Grenzwerte
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte:
MAK (Max. Arbeitsplatzkonzentration) 0,5-1 mg/m³ Luft
TDI (tolerable daily intake): 1 µg/kg/d
TVO (Trinkwasserverordnung): 0,5 µg/l
nach IARC (International Agency for Reserch on Cancer) sind PCB’s als Gruppe 2A: wahrscheinlich kanzerogen am Menschen eingestuft
nach DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) sind PCB’s als Gruppe IIIB: begründeter Verdacht auf krebserzeugendes Potential
Information als PDF-Download:
Polychlorierte Biphenyle (PCB)
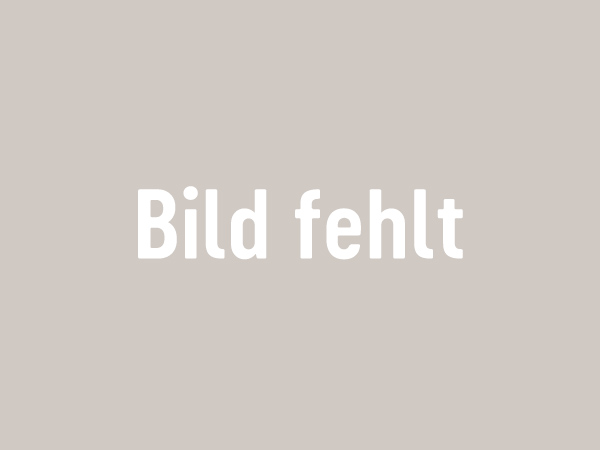
| Medium | Richtwerte |
|---|---|
| Blut | < 0,01-0,6 µg/l (altersabhängig!) |
| Fettgewebe | < 330 µg/kg |
| Hausstaub | < 0,1 mg/kg |
| Feststoffe | < 0,1 mg/kg |
| Luft | MAK = 0,5 – 1 mg/m³ |
| Muttermilch | < 1,51 mg/kg |
| Trinkwasser | < 0,5 µg/l TVO |
Weichmacher
1) Mögliche Quellen für Weichmacher:
Textilien, Montageschäume und andere Schaumkunststoffe, Polyvinylchlorid PVC, Farben und Lacke, Kunststoffe z.B auch von Lebensmittelverpackungen, Elektrokabel, Klebstoffe, Kosmetika, fettfreie Schmiermittel, Schaumverhüter, medizinische Produkte (z.B. Transfusionsbehälter)
2) Stoffe
- Phthalate:DEHP (Di-2-ethylhexylphthalat), DBP (Di-n-butyl-phthalat), BBP (n-Butylbenzyl-phthalat), DMP (Dimethyl-phthalat), DEP (Diethyl-phthalat), DOP (Dioctyl-phthalat), Phthalsäureanhydrid
- Polychlorierte Biphenyle (PCB)
3) Mögliche Symptome:
Über gesundheitliche Auswirkungen dieser Stoffe liegen nur wenige Erkenntnisse vor. Bei einigen ist im Tierversuch ein krebserzeugendes Potential nachgewiesen worden und sie wurden auch beim Menschen als wahrscheinlich krebserzeugend eingestuft (DEHP). Man vermutet Zusammenhänge mit Beschwerden des sog. Sick-Building-Syndroms. Für Phthalate sind bei chronischer Exposition nerven- und immunsystemschädigende Wirkungen beschrieben.
Belastungen mit Flammschutzmitteln u.a. Innenraumschadstoffen werden mit einer Überlastung des körpereigenen Entgiftungssystems sowie der Erschöpfung notwendiger Cofaktoren, wie es bei „Umweltpatienten“ und Allergikern häufig beobachtet wird, in Verbindung gebracht. Gleiches gilt für die Gruppe der Weichmacher.
Weichmacher besitzen hormonartige Wirkungen im menschlichen Körper und stehen damit im Verdacht, für Zyklusstörungen, Unfruchtbarkeit u.ä. mitverantwortlich zu sein.
Informationen über PCB entnehmen Sie bitte der entsprechenden Kurzinformation.
4) Grenzwerte
Es gibt für den Wohnraumbereich keine Grenz- oder Richtwerte.
Daten über durchschnittliche Wohnungsbelastungen fehlen noch.
Die ARGUK Umweltlabor GmbH gibt als Orientierungswert für geringe Phthalatbelastungen im Hausstaub Konzentrationen bis 100 Milligramm / kg an und sieht über 500 Milligramm / kg Handlungsbedarf.
Das Labor Dr. Med. Schiwara et.al. gibt als Orientierungswert 250 Milligramm / kg für die Summe DEHP + DBP im Hausstaub an.
Im Arbeitsplatzbereich gelten folgende Grenzwerte:
DEHP: MAK-Wert 10 Milligramm / m³ Luft
Die akute Toxizität der Verbindungen wird von den LD50-Werten beschrieben. Diese sagen aus, bei welcher Konzentration die Hälfte einer Versuchstierpopulation stirbt:
DEHP: LD50 (Ratte, oral) = < 26 g/kg
DBP: LD50 (Ratte, oral) = 8-23 g/kg
Informationen über PCB entnehmen Sie bitte der entsprechenden Kurzinformation.
Information als PDF-Download:
Weichmacher

Chlorparaffine
1.) Verwendung und mögliche Quellen für Chlorparaffine:
Chlorparaffine sind Kohlenwasserstoffketten verschiedener Länge mit unterschiedlichem Chlorierungsgrad. Da sie schwer entflammbar sind, werden sie als Flammschutzmittel in Gummi, Kunststoffen, Papier und Textilien, als Weichmacher in Kunststoffen und Beschichtungen, als Bindemittel in Lacken, sowie in Fettungsmitteln für Leder und Pelzwaren eingesetzt. Häufig werden Chlorparaffine heute als Ersatzstoff für PCB verwendet. Kurzkettige Paraffine (C10-13) werden in Deutschland für den textilen Flammschutz nicht mehr eingesetzt, finden jedoch im Ausland noch Verwendung.
2.) Aufnahme in den Körper:
Die Aufnahme erfolgt über die Haut. Eine Aufnahme über Inhalation wird noch diskutiert.
3.) Mögliche Symptome:
Die akute Toxizität von Chlorparaffinen ist gering. Die chronische Toxizität nimmt zu, je kurzkettiger die Chlorparaffine sind. Über Ausgasungen aus Materialien liegen bislang nur wenige gesicherten Daten vor, diese zeigen aber, dass Ausgasungen bei der Verwendung von kurz- und mittelkettigen (C14-17) Chlorparaffinen relevant vorhanden sind.
Die Hauptproblematik bei Chlorparaffinen ist die Kanzerogenität. In Tierversuchen wirkten sie eindeutig Krebs auslösend. Bei Ratten und Mäusen führte die längere Applikation von kurzkettigen Chlorparaffinen zur Zunahme der Leber- und Nierengewichte, zu Gewichtsreduktion, zu Gewebeläsionen und Karzinomen an verschiedenen Organen.



